Tante Martl: Roman
Pressestimmen »Eine feinfühlige und humorvolle Geschichte über die weibliche Freiheit und die Generation vor der Emanzipation.«, Landlust Published On: 2020-01-01»Das Buch, eines der schönsten Bücher der Saison […], ist eine liebevolle Hommage.«, Die Rheinpfalz Published On: 2019-12-19»Eine wunderbare Frauenbiografie, die auch für Männer unbedingt lesenswert ist.«, Melsunger Allgemeine Published On: 2019-12-05»Eine feine Geschichte über eine erstaunliche Frau, die sich behauptet. Was kann munterer machen als jemand, der beherzt seinen Weg geht?«, Frankfurter Allgemeine Zeitung Published On: 2019-12-04»Berührend, humorvoll.«, Hessische Allgemeine Published On: 2019-12-04»[Ursula März] erzählt aus ihrer Familiengeschichte, anschaulich, einfühlsam und analysierend.«, lesen.bayern.de Published On: 2019-12-01»Ursula März (…) erzählt humorvoll und mit viel Empathie in ihrem Roman das Leben ihrer Tante.«, WiWa-lokal.de Published On: 2019-11-17»Ursula März gelingt ein großes Buch über diese vermeintlich kleine Existenz.«, SWR2 lesenswert Magazin Published On: 2019-11-10»Tolle Charaktere und jede Menge Situationskomik machen das Buch von Ursula März zu einem köstlichen Lesevergnügen.«, Mittelbayerische Published On: 2019-11-10»Ein wunderbares Buch für alle, die sich mit der Nachkriegsgeneration verbunden fühlen, von Ursula März mit viel Respekt und einer Spur Bewunderung auf Papier gebracht«, Altmühl Bote Published On: 2019-11-09 Klappentext Ein faszinierendes Frauenleben in Nachkriegszeit und WirtschaftswunderTante Martl hat ihren Vater schon bei der Geburt enttäuscht, denn als dritte Tochter hätte sie endlich ein Martin sein sollen. Wie es kommt, dass sie ihn bis ans Ende seines Lebens versorgt und doch eigenständig bleibt, erzählt dieser Roman aus der Perspektive ihrer Nichte. Es ist die berührende Geschichte einer selbstlosen und eigensinnigen Frau und das Porträt einer ganzen Generation.»So gut geschrieben, dass man gar nicht aufhören will.« Claudius Seidel, FAS»Ein liebevolles, einfühlsames und höchst unterhaltsames Buch.« Stern»Ein bewegendes Frauen-, Familien- und Gesellschaftsportrait.« SFR2 Kultur Buchrückseite Ein faszinierendes Frauenleben in Nachkriegszeit und Wirtschaftswunder Tante Martl hat ihren Vater schon bei der Geburt enttäuscht, denn als dritte Tochter hätte sie endlich ein Martin sein sollen. Wie es kommt, dass sie ihn bis ans Ende seines Lebens versorgt und doch eigenständig bleibt, erzählt dieser Roman aus der Perspektive ihrer Nichte. Es ist die berührende Geschichte einer selbstlosen und eigensinnigen Frau und das Porträt einer ganzen Generation. »So gut geschrieben, dass man gar nicht aufhören will.« Claudius Seidel, FAS »Ein liebevolles, einfühlsames und höchst unterhaltsames Buch.« Stern »Ein bewegendes Frauen-, Familien- und Gesellschaftsportrait.« SFR2 Kultur Über den Autor und weitere Mitwirkende Ursula März, geboren 1957 in Herzogenaurach, studierte Literaturwissenschaften und Philosophie in Köln und Berlin. Seit Anfang der 1990er Jahre arbeitete sie als Literaturkritikerin und Feuilletonistin unter anderem für die Kulturzeitschrift Kursbuch, für die Frankfurter Rundschau und für die Wochenzeitung DIE ZEIT. Sie erhielt 1991 den Preis der Casinos Austria für Publizistik und 2005 der Berliner Preis für Literaturkritik. Bei Hanser erschienen Fast schon kriminell: Geschichten aus dem Alltag (2011) und Für eine Nacht oder fürs ganze Leben: Fünf Dates (2015). Tante Martl ist ihr erster Roman. Leseprobe. Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Rechteinhaber. Alle Rechte vorbehalten. Wenn meine Tante mir am Telefon etwas erzählen wollte, das sie gerade sehr erregte, leitete sie ihren Bericht mit einem lang gezogenen Stöhnen ein, in dessen Tonlage sich ein leicht kindliches Jammern mit dem Jaulen einer Alarmsirene mischte. Bevor sie auch nur einen Satz gesagt hatte, konnte ich anhand der Intonation des Stöhnens schon erahnen, was ihr auf dem Herzen lag. Hatte sie sich über eine schnippische Verkäuferin geärgert, überwog die Sirene. Hatte der Hausarzt ihr geraten, sich für eine Untersuchung ins Krankenhaus einweisen zu lassen, schlug das Jammern durch. Bisweilen vertiefte sich das Stöhnen zu einem rollenden Brummen, als säße am anderen Ende der Leitung ein angriffslustiger Bär. Dann war meine Tante ernsthaft empört. Der Lieferant von Tiefkühlkost, der einmal im Monat mit seinem Kleinlaster vor ihrem Haus hielt, hatte die falsche Ware gebracht, aber unverschämt behauptet, es sei die richtige, und den Umtausch verweigert. In einer Fernsehsendung waren knapp bekleidete Frauen aufgetreten, und zwar nicht am späten Abend, wenn meine Tante längst schlafen gegangen war, sondern im unverdächtigen Nachmittagsprogramm. Ein Daueranlass ihrer Empörung war der Showmaster Thomas Gottschalk. Er wurde von meiner Tante so verachtet, dass sie nicht einmal seinen Namen aussprach, sondern ihn nur »de dumm Lackaff« nannte. Sie konnte sich nicht damit abfinden, dass »de dumm Lackaff« in der Samstagabendshow des ZDF den Platz des von ihr hochgeschätzten Frank Elstner eingenommen hatte, was meine Tante als persönliche Geringschätzung von Menschen wie ihr, Menschen mit Anstand und seriösem Benehmen, interpretierte. Alles an Thomas Gottschalk fand sie vulgär, seine langen blonden Locken, seine Glitzeranzüge, seine Witze. Als sie in einer Fernsehzeitschrift las, wie viel Geld er für seine Shows erhielt, war sie außer sich. »Ursi«, schrie sie ins Telefon, »des sin Millione! Des isch doch net normal!« Ich versuchte, sie zu beruhigen. Thomas Gottschalk, sagte ich, sei sicherlich Millionär und habe einigen Reichtum angehäuft. Dass er für einen einzigen Fernsehauftritt gleich ein paar Millionen einstriche, hielte ich jedoch für ausgeschlossen. »Du hascht doch ke Ahnung«, erwiderte sie brüsk, nun über meine Besserwisserei empört. Ich kannte mich in den Finanzverhältnissen von Thomas Gottschalk tatsächlich nicht aus und bog schnell zu einem anderen Thema ab. Wenn am Sonntagmorgen in meiner Wohnung in Berlin das Telefon klingelte, ich den Hörer abnahm und dem Empörungsstöhnen lauschte, war mir klar, dass am Abend zuvor »Wetten, dass …?« ausgestrahlt worden war, meine Tante auf dem Bildschirm ihren Intimfeind gesehen und sofort umgeschaltet hatte. Bis sie endlich zu erzählen begann, konnte eine Weile vergehen. Mit einer einzigen Stöhnouvertüre war es oft nicht getan. »Was ist denn passiert?«, fragte ich vorsichtig. »Geht’s dir nicht gut?« Anstatt zu antworten, stöhnte sie erneut, und ich fuhr wieder mit einer Frage dazwischen. Je älter meine Tante wurde, desto häufiger geschah es, dass sie schon nach dem Ende des Stöhnens meinen Kommentar zu dem Ereignis erwartete, das sie veranlasst hatte, mich anzurufen. So, als hätte sie mir gerade davon erzählt. Es war ein heikler Moment unserer Telefonate. Dauer und Tonlage des Stöhnens verrieten mir die Stimmung, in der sich meine Tante befand. Aber was genau sie in diese Stimmung versetzt hatte, wusste ich natürlich nicht. Vielleicht hatte sie eine überhöhte Rechnung ihrer Autowerkstatt erhalten, die darauf spekulierte, eine betagte Frau würde den Wucher nicht bemerken. Vielleicht musste sie ihrem Ärger über ein im gegenüberliegenden Haus lebendes Ehepaar Luft machen, das an sieben Tagen die Woche um Punkt 11:30 Uhr in seinen Mercedes stieg, um in ein Restaurant zu fahren. »Die kenne esse, wo se wolle«, sagte meine Tante, »aber jede Tach ins Lokal gehe, des isch doch net normal.« Sie war fest davon überzeugt, der Grund für die gehäuften Restaurantbesuche der Nachbarn, die schon bei dünnem Nieselregen die Rollläden vor den Fensterscheiben herunterzögen, läge in einem Reinlichkeitswahn, der es ihnen verbiete, ihre Küche durch das Zubereiten einer warmen Mahlzeit zu besudeln. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich mit vagen Beschwichtigungsfloskeln an das Ereignis heranzutasten, von dem meine Tante glaubte, sie hätte es mir eine Minute zuvor mitgeteilt. Oft bemerkte sie die Taktik und fühlte sich zurückgestoßen, weil es mir ihrer Ansicht nach an echtem Interesse für sie und ihre Nöte fehlte. »Isch stör dich, gell?«, sagte sie dann pikiert. »Bischt aufm Drücker?« Aber nein, beteuerte ich, sie störe überhaupt nicht, ich mache ohnehin gerade eine kurze Arbeitspause und läge auf der Couch. »Ei, dann sach doch gleich, dass de schloofe willscht«, murrte sie weiter, »des kann isch jo net wisse. Isch sitz am Telefon und net am Fernrohr.« Meine Tante war Lehrerin von Beruf. Sie heiratete nie und hatte keine Kinder. Außer ein paar Jahren während des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit verbrachte sie ihr gesamtes Leben in ihrem Elternhaus in der westpfälzischen Kleinstadt Zweibrücken. Der einzige Wechsel ergab sich nach dem Tod ihrer Eltern, als meine Tante aus ihrer Wohnung im Erdgeschoss in das nun frei gewordene Obergeschoss zog. Danach verbrachte sie noch achtunddreißig Jahre allein in dem Haus, in dem sie an einem Junisonntag im Jahr 1925 geboren worden war. Sie war eine materiell unabhängige, interessierte und gebildete Frau, die schon in den Fünfzigerjahren ein eigenes Auto und immer ein eigenes Bankkonto besaß, die leidenschaftlich gern verreiste, mit kribbelnder Vorfreude ihre Touren in Mittelmeerländer, ins Gebirge und sogar ans Nordkap plante. Aber sie unternahm nie einen Versuch, sich vom Elternhaus zu lösen, zumal von einem Vater, der sie rücksichtslos spüren ließ, dass er sie nicht gewollt hatte. In ihrer ersten Lebenswoche, genau von Montag bis Montag, galt meine Tante auf dem Papier als Person, vielmehr als Säugling, männlichen Geschlechts. Sieben Tage lang war ihr Vater nicht bereit, sich mit der Tatsache abzufinden, dass auch dieses Kind ein Mädchen geworden war. Zu seinem Verdruss das dritte. Schon das zweite Mädchen hätte, wären die Dinge seiner Ansicht nach richtig verlaufen, ein Junge sein müssen. Er verschmerzte es einigermaßen. Gegen ein drittes Geschöpf aber, das als Stammhalter ausfiel und ihm womöglich den Ruf eines Erzeugers eintrug, der nur eine Mädchenserie zustande brachte, stellte er sich stur. Bei seinen Enkeln war ihm das Geschlecht egal. Ich erinnere mich an keine Situation, keinen Satz und kein Geschenk, die darauf hingedeutet hätten, er bevorzuge meinen Bruder mir gegenüber. Bei seinen Kindern galten jedoch andere Prinzipien. Sieben Tage lang klammerte er sich an die wahnwitzige Illusion, der Natur durch schieres Beharren doch noch ein Chromosomenwunder abringen zu können. In den Verwaltungsakten des örtlichen Standesamtes gab es den Jungen ja schon, er hieß Martin. Als sich mein Großvater am Montagmorgen vor dem Schreibtisch des Standesbeamten einfand und dieser ihn nach dem Geschlecht des neuen Erdenbürgers fragte, nickte er einfach. Er sprach das Wort »Junge« nicht aus. Er wartete, bis dem verunsicherten Beamten, der die Spitze des Füllfederhalters bereits aufs Formular gesetzt hatte, nichts anderes übrig blieb, als die Frage zu konkretisieren, »isch e Bub?«, und er nur nicken musste. Im strengen Sinn gelogen, so beteuerte er noch nach Jahrzehnten, hatte er also nicht. Er hatte es lediglich verpasst, einer Variante der Wahrheit zu widersprechen, die ihm amtlicherseits nahegelegt wurde. Und was den falschen Namen anbetraf: Vielleicht hatte er den Vokal am Ende verschluckt, vielleicht hatte der Standesbeamte das »a« überhört oder einfach den Stift zu früh abgesetzt und deshalb den Namen Martin eingetragen. Ungefähr so lauteten die Ausreden, die er vorbrachte, als seine Frau ihm am Dienstag die Geburtsurkunde abknöpfte und schwarz auf weiß lesen musste, dass...
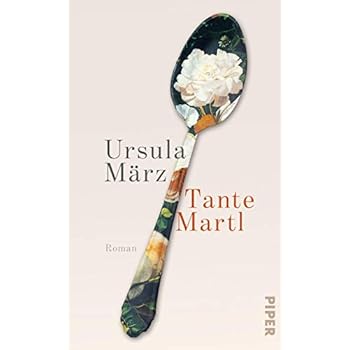
holen Solche echt augenblicklich Die Exemplar
